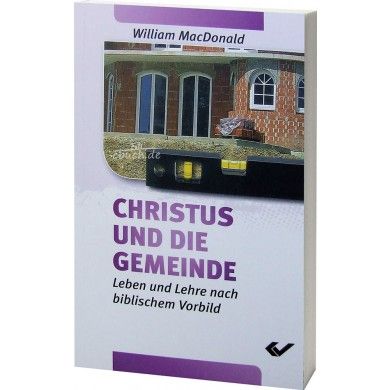
In seinem Buch Christus und die Gemeinde, das aktuell in der vermutlich inzwischen fünften (übersetzten) Auflage in der Dillenburger Verlagsgesellschaft vorliegt, behandelt William MacDonald auf 128 Seiten viele wichtige Themen, die mit der Versammlung Gottes zu tun haben.
Inhalt
Nach einer Einleitung, in der MacDonald darüber spricht, was nach seinem Verständnis „Versammlung“ (Gemeinde) bedeutet, geht er besonders auf sieben aus seiner Sicht besonders wichtige Wahrheiten ein:
- Da ist ein Leib.
- Christus ist das Haupt der Versammlung.
- Alle Gläubigen sind Glieder des Leibes.
- Der Heilige Geist ist der Stellvertreter oder Sachwalter Christi in der Versammlung.
- Die Versammlung ist heilig.
- Für die Auferbauung der Versammlung hat Christus Gaben gegeben.
- Alle Gläubigen sind Priester Gottes.
Im Anschluss daran geht MacDonald dann zusätzlich noch auf die Taufe, das Gedächtnismahl, die Gebetsversammlung, Aufseher, Diakone, die Finanzen in der örtlichen Versammlung und den Dienst der Frauen ein. An den Schluss stellt er ein Kapitel darüber, wie wichtig es ist, zu Ihm hinauszugehen, getrennt vom Bösen.
Positiv
Der Autor stellt die Themen sehr anschaulich und gut lesbar vor. Immer wieder bezieht er sich auf Gottes Wort und zeigt, wie das Neue Testament an vielen Stellen über die Versammlung spricht. Sowohl die Heiligkeit Gottes als auch seine Liebe werden in einer guten Balance dargestellt, auch in dem Sinn, wie sie unser Versammlungsleben prägen sollen. In diesem Sinn gibt es eine Reihe von sehr hilfreichen Hinweisen zum Thema „Zucht“.
Man findet zu einer Fülle von Einzelheiten rund um das Thema „Gemeinde“ nützliche und zum Nachdenken anregende Gedanken. Da sich MacDonald sehr bemüht, seine Gedanken auf Gottes Wort abzustützen, fällt es dem Leser leicht, das Ganze an Gottes Wort zu prüfen.
Die offenen Brüder
Damit kommen wir zu dem wesentlichen Problem dieses Buches: Wie im Teaser angesprochen, ging William MacDonald zu den sogenannten offenen Brüdern. Diese entstanden 1848 als eigene Gruppe, als in einer örtlichen Versammlung falsche Lehren über die Versammlung und die Person des Herrn Jesus verbreitet wurden, böse Lehren, was aber die Gläubigen in Bethesda, wo Georg Müller wohnte, nicht davon abhielt, solche Gläubige, die mit dem falschen Lehrer Gemeinschaft am Tisch des Herrn hatten, zum Brotbrechen aufzunehmen.
Diese dann „offene Brüder“ genannten Zusammenkommen offenbarten somit Gleichgültigkeit gegenüber der Person des Herrn Jesus. Zugleich nahmen sie eine Überzeugung im Blick auf örtliche Versammlungen an, die bislang so nicht gekannt war. Für sie war und ist die örtliche Versammlung souverän, selbstständig und unabhängig von allen anderen örtlichen Versammlungen. Niemand darf in sie hineinregieren, niemand kann ihr sagen, was sie tun soll, sie kann unabhängig von den Entscheidungen „verbundener“ anderer örtlicher Versammlungen ihre eigene Entscheidung treffen.
Die Einheit des Geistes
Ein Bibelleser, der die Hinweise des Apostels Paulus in Epheser 4,1-4 von dem einen Leib liest und der Aufforderung, die Einheit des Geistes zu bewahren, hat keine Schwierigkeiten, diese Gedanken als unbiblisch zurückzuweisen. Es wäre ein Widerspruch zur Einheit, wenn Versammlung A jemand aufnimmt, der in Versammlung B nicht aufgenommen worden ist. Spätestens, wenn jemand aus Versammlung B dann zur Versammlung A kommt und mit demjenigen das Brot bricht, wird offenbar, wie abwegig eine solche Vorgehensweise ist. Es ist das Gegenteil von Einheit.
Paulus sagt nicht von ungefähr etliche Male, dass das, was er in Korinth lehrte, in allen Versammlungen galt. Dass davon die Frage der Aufnahme am Tisch des Herrn ausgeschlossen sein soll, wird ihm wohl niemand andichten wollen.
Der Charakter der örtlichen Versammlung
Diese Hinweise helfen auch jungen Gläubigen, gerade in Büchern, die ihnen zum Thema „Versammlung“ empfohlen werden, besonders darauf zu achten, in was für einer Weise der Charakter der örtlichen Versammlung beschrieben wird. Wenn erkannt wird nach 1. Korinther 12,27, dass die örtliche Versammlung die Darstellung und Repräsentation der weltweiten Versammlung ist, kann er innerlich ein „Ja“ sagen. Denn die weltweite Versammlung kann ja eine Person nicht zugleich aufnehmen und ablehnen.
Vor diesem Hintergrund sind gerade die Abschnitte über die örtliche Gemeinde (S. 22 ff.) und die Aufnahmekriterien (S. 34 ff. und 82) sehr kritisch zu werten. Hier spricht William MacDonald von der Souveränität und damit Unabhängigkeit der örtlichen Gemeinde. Zugleich beschränkt er sich bei den Aufnahmekriterien darauf, dass man persönlich rein sein muss in seinem Leben. Die gemeinschaftliche Verantwortung, die Verantwortung im Blick auf Verbindungen mit anderen, wird nicht behandelt.
Leider kommt der Autor im Laufe des Buches immer wieder auf diese unbiblische Auffassung zurück, so dass der an sich gute Eindruck des Buches konterkariert wird. Denn diese falschen Punkte durchziehen das gesamte Buch. Wer also Gottes Gedanken über seine Versammlung kennenlernen möchte, sollte zu diesem Buch nicht greifen und sich auch nicht durch die Popularität des Autors irreführen lassen. Er bekommt durch dieses Werk eine verzerrte Sicht der Versammlung Gottes, jedenfalls in ganz wesentlichen Aspekten dieser Wahrheit.
Quelle: bibelpraxis.de/a3578.html

